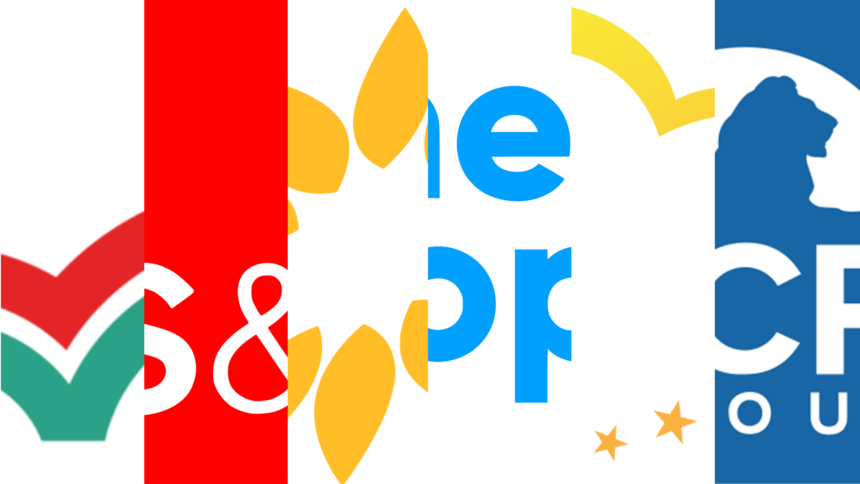Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.
Europawahl 2024: Was in den Wahlprogrammen steht
Wofür stehen die Fraktionen im Europaparlament? Die meisten Wähler:innen haben darüber keinen Überblick. Wir haben uns deshalb Wahlprogramme durchgelesen – und fassen die digitalpolitischen Teile zusammen. Es geht um Migration, Künstliche Intelligenz, den Digitalen Euro und vieles mehr.
Die Europawahl ist ein seltsames Ding. 450 Millionen Europäer:innen wählen ein Parlament, damit ist sie die zweitgrößte demokratische Wahl der Welt. Aber eigentlich müsste man eher von Europawahlen im Plural sprechen, denn eine einheitliche Wahl gibt es nicht: Die Bürger:innen der 27 Mitgliedstaaten wählen jeweils ihre nationalen Parteien. Die schließen sich dann zu europäischen Parteien und schließlich zu Fraktionen im Parlament zusammen.
Die Namen dieser Fraktionen kennt in Deutschland kaum jemand. Die Grünen sind ein Begriff, aber was will bitte die Europäische Freie Allianz? Und wer sind die Konservativen und Reformer? Anders als in Deutschland, wo Abgeordnete in der Regel mit ihrer Fraktion stimmen, sind EU-Abgeordnete dabei völlig frei. Wenn sie an die richtigen Posten kommen, also etwa für wichtige Gesetzesvorhaben zuständig sind, dann haben sie einzeln viel mehr Macht als ihre Kolleg:innen in den Mitgliedstaaten.
Fraktionen, zusammengesetzt aus nationalen Parteien mit eigenen Hintergründen und Grabenkämpfen, dazu noch einzelne Abgeordnete mit viel Autonomie – das sieht von außen oft sehr chaotisch aus. Wen also wählen?
Wir haben uns die Wahlprogramme der demokratischen Fraktionen und Parteien durchgelesen, natürlich mit Fokus auf die Digitalpolitik. Hier die interessanten Teile der Parteien, die in einer ausführlichen INSA-Umfrage aus dem März mindestens 0,5 Prozent erreicht haben – in alphabetischer Reihenfolge der Fraktionen. Wenn vorhanden wurde das Programm der europäischen politischen Partei betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
CDU/CSU (EVP)
Die größte Fraktion im Europäischen Parlament stellt die Europäische Volkspartei (EVP). Aus Deutschland sind die beiden Unionsparteien – CDU und CSU – Mitglieder in der Partei, ein Abgeordneter der Familienpartei sitzt zusätzlich in der EVP-Fraktion im Parlament. Die aktuelle Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat ein EVP-Parteibuch.
Die Partei unterstützt den harten Aufrüstungskurs an den EU-Grenzen. „Der Zugang zu den äußeren Grenzen der EU muss umfassend elektronisch überwacht werden“, heißt es im Parteiprogramm für die anstehende Wahl. Die skandalumgebene Frontex-Agentur soll dreimal so viele Beamte, mehr Befugnisse und ein höheres Budget bekommen.
Auch das Personal von Europol, der europäischen Polizeibehörde, soll verdoppelt werden. Polizeibehörden sollen auch einfacher Zugang zu mehr Daten bekommen: Die Partei unterstützt die Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen. Nationale Datenbanken sollen mit denen von internationalen Sicherheitsbehörden verbunden werden, damit Polizei und Nachrichtendienste aller Mitgliedstaaten frei untereinander Daten austauschen können.
Die EVP fordert eine stärker integrierte europäische Verteidigung, auch im Cyberbereich. Dazu gehört auch Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz, für zivile und militärische Zwecke. Um gegen Cyberkriminalität vorzugehen, will die Partei eine gemeinsame europäische „Cyber-Brigade“ einrichten, die für äußere und innere Sicherheit zuständig sein soll.
Allgemein sieht die EVP KI sehr positiv: Sie plant ein „digitales Erwachen“ für Europa, dessen zweiter Teil KI-Forschung und Entwicklung von KI-Anwendungen sein soll. „Dafür müssen wir unseren Datenschutz an die Anfordernisse der digitalen Welt anpassen“, heißt es im Parteiprogramm. Auch die Grundrechte-Charta der EU will die Partei anpassen, damit Rechte in der „digitalen Welt“ respektiert werden.
Die Rechte von Arbeiter:innen und Selbstständigen will die EVP mit einer „Garantie für Europäische Arbeiter:innen im Digitalen Markt“ schützen, dabei aber auch die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten respektieren. Homeoffice soll Eltern eine bessere Balance zwischen Arbeit und Familie erlauben. Um Kinder zu schützen, will sie „Cyber-Mobbing“ in ganz Europa als Straftat einstufen.
Familien-Partei (EVP)
Die Familien-Partei hat wenig digitalpolitische Inhalte in ihrem Programm. Aber sie befürwortet den Digitalen Euro, um “Direktzahlungen an die Bürgerinnen und Bürger unbürokratisch zu ermöglichen“.
Verteidigungsarmeen will sie besser vernetzen und hält einen „entsprechenden Datenaustausch“ für die Sicherheit von Bürger:innen für „unerlässlich“. Mehr Austausch soll es auch zwischen sonstigen Behörden bei der Terror- und Kriminalitätsbekämpfung geben. Dazu gehört für die Familien-Partei der Zugriff auf gemeinsame Datenbanken.
Grüne (Grüne/Europäische Freie Allianz)
Die Grünen sind im EU-Parlament Teil der Fraktion Die Grünen/Europäische Freie Allianz (EFA). Hinter dem komplizierten Namen stehen hauptsächlich die europäischen Grünen, bei denen haben wiederum die deutschen Grünen die meisten Abgeordneten. Dazu kommen einzelne Abgeordnete anderer Parteien, zu denen später mehr.
Die europäischen Grünen fordern ein Recht darauf, nicht getrackt zu werden. Um Frauen und ethnische Minderheiten zu schützen, soll es für besonders schwere Hassrede EU-weite Minimalstrafen geben. Das Gesetz zu Digitalen Diensten wollen die Grünen durchsetzen und Plattformen zu mehr effektiver Transparenz verpflichten.
EU-Gesetzgebung soll Bürger:innen vor Spyware-Missbrauch schützen. Mitgliedstaaten sollen nicht mehr einfach unter dem Schutz der „nationalen Sicherheit“ tun und lassen dürfen, was sie wollen, wie es beim Pegasus-Skandal passiert ist. Autonome Waffen, also „Killerroboter“, will die Partei verbieten.
KI hat für die Grünen Potenzial und Gefahren: „Künstliche Intelligenz muss für Menschen, die Gesellschaft und den Planeten funktionieren, nicht für Überwachungsstaaten oder den Tech-Kapitalismus“, schreiben sie. Biometrische Massenüberwachung wollen sie verbieten, genau wie das automatische Erkennen von Emotionen. KI soll nicht diskriminieren dürfen und erkennbar sein müssen.
Die Grünen wollen auch die Rechte von Verbraucher:innen stärken. Online-Marktplätze sollen von Zollbehörden gemeinsam geprüft werden. Die Verarbeitung von Daten und Kryptowährungen soll weniger Strom verbrauchen, digitale Geräte sollen recycelt werden. Ein Gesetz für „digitale Fairness“ soll Bürger:innen vor invasiven Online-Werbepraktiken schützen – eigentlich das Ziel der ePrivacy-Verordnung, die aber seit Jahren feststeckt. Reisen wollen die Grünen mit einer europäischen Plattform für Zugtickets vereinfachen.
Die Partei fordert ein EU-weites Recht auf Abschalten und auf Home Office. Plattform-Arbeiter:innen sollen als Angestellte anerkannt werden und auch die gleichen Rechte bekommen.
Ein Europäischer Datenraum soll anonymisierte Daten für Klima- und Medizinforschung zur Verfügung stellen. Mit Interoperabilität und offenen Standards wollen die Grünen Entwickler:innen, Zivilgesellschaft und kleine Unternehmen stärken. Ein neuer Status als Europäische Künstler:in soll Kulturschaffende beim Wechsel zwischen Mitgliedstaaten schützen, besonders auf Streamingplattformen.
Piraten (Grüne/Europäische Freie Allianz)
Die europäische Piratenpartei ist ebenso Teil der Grüne/EFA-Fraktion. Die deutschen Piraten stellen momentan einen Abgeordneten, die anderen drei kommen aus Tschechien. Wenig überraschend gibt die Partei digitalen Themen in ihrem Programm wesentlich mehr Platz als andere: Drei ganze Kapitel widmet das Piraten-Parteiprogramm den Themen Freie Software und offene Daten, Menschenrechte im Digitalen Zeitalter und Netzpolitik.
„Bei der Entwicklung von KI sollten die höchsten ethischen Standards eingehalten und diskriminierende Vorurteile oder Profiling ausgeschlossen werden“, heißt es im Programm der Piraten. Der Bereich sollte deshalb genau geregelt werden. KI dürfe nicht die Fähigkeit einschränken, individuelle Entscheidungen zu treffen.
Die Piraten wollen Europa gegen „aktuelle und zukünftige Bedrohungen“ durch Desinformation, Cyberangriffe und wirtschaftlichen Zwang schützen. Dafür soll die EU gemeinsame Leitlinien zur Verteidigung formulieren und auch die Fähigkeiten aufbauen, um diese zu erreichen.
Das aktuell laufende EU-Projekt für eine Identitätswallet unterstützen die Piraten, wollen aber einen strengen Datenschutz. Ein europäisches Gesetz über die Informationsfreiheit soll die Transparenz verbessern und auch den Zugang zu Daten umfassen. Ein Moratorium für neue Massenüberwachungsgesetze soll besonders die Chatkontrolle verhindern, aber auch Altersüberprüfungen und die Vorratsdatenspeicherung.
Der Europäische Gesundheitsdatenraum soll angemessen geschützt werden. „Wir verstehen, dass Gesundheitsdaten für die Wissenschaft nützlich sind“, schreiben die Piraten. Sie könnten aber auch von Versicherungen oder Arbeitgebern missbraucht werden. Die Daten sollten deshalb anonymisiert und verschlüsselt werden.
Für die Verwaltung soll der Grundsatz „öffentliches Geld, öffentlicher Code“ gelten. Wann immer möglich, sollen Behörden freie Software einsetzen und Bürger:innen per freier Software mit ihnen kommunizieren dürfen. Die EU-Mitgliedstaaten sollen Stellen einrichten, die Open-Source-Projekte ihrer nationalen Verwaltungen bündeln.
Die Piraten fordern ein Recht auf Internetzugang „ohne unzumutbare Schwierigkeiten, Belastungen oder Kosten“. Dafür sollen alle Menschen in der EU Zugang zu Breitbandinternet bekommen. Außerdem wollen die Piraten die Netzneutralität und Meinungsfreiheit im Internet schützen.
Das neue EU-Gesetz zu digitalen Märkten verpflichtet große Messenger-Dienste, interoperabel zu werden – das soll nach Willen der Piraten auch für soziale Netzwerke gelten. Die Piraten wollen offene Software finanzieren und zu ihrer Entwicklung beitragen. Die EU soll aber keine Technologie finanzieren, die in Grundrechte eingreift. Außerdem soll die Zivilgesellschaft an öffentlichen Ausschreibungen beteiligt werden.
„Wir Piraten sehen das Potenzial von Kryptowährungen und dass sie eine positive Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung spielen können“, heißt es Programm der Piraten. Sie wollen außerdem das Bargeld wegen seiner Anonymität und Stabilität schützen. Sie meinen damit auch digitales Bargeld wie den aktuell geplanten Digitalen Euro.
Volt (Grüne/Europäische Freie Allianz)
Auch Volt sitzt mit in der Grüne/EFA-Fraktion. Kernpunkt ihres Programms ist mehr europäische Integration. Es schlüsselt außerdem auf, wie viel die Forderungen der Partei kosten werden und wie sie diese Kosten finanzieren will. Ein Punkt ist dabei, digitale Dienstleistungen zu besteuern. So will Volt in den nächsten fünf Jahren 625 Milliarden Euro in die Kassen der EU spülen.
Ungefähr die Hälfte davon will die Partei in öffentliche Güter reinvestieren, etwa in Bildung oder Cybersicherheit. Die EU soll bei der Herstellung von Halbleitern wichtiger werden, bis 2030 sollen 20 Prozent der weltweit produzierten Chips aus Europa kommen. Das entspricht dem Ziel, dass sich die EU mit ihrem Chips Act selbst gesetzt hat.
Auch die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung soll besser ausgestattet werden. Die EU-Verwaltung soll mehr Zugang zu Open-Source-Software bekommen und auch deren Entwicklung finanziell unterstützen. Dafür soll der Grundsatz „Öffentliches Geld, öffentlicher Code“ gelten. Außerdem will Volt länderübergreifende „Innovationsteams“ und eine EU-Initiative für IT-Traineeships. Öffentliche Daten, auch zum EU-Politikprozess, sollen breiter veröffentlicht werden.
Neue Gesetze sollen nach dem Willen von Volt die Entwicklung digitaler Technologien erleichtern. Dabei soll die „Wahrung europäischer Werte und die Schaffung von Zukunftsindustrien“ im Vordergrund stehen. Bürger sollen außerdem etwa über den Stand der Sicherheit bei kritischer Infrastruktur informiert werden. Hassverbrechen und digitale Gewalt sollen stärker bestraft werden. Der Ausschuss für Bürgerrechte des EU-Parlaments soll bei neuen digitalen Gesetzesvorhaben immer mitreden dürfen.
Volt will das „Recht auf Reparatur“ stärken. Die Partei will außerdem einen Digitalen Euro ohne Obergrenze auf einzelnen Konten. Für Bahnreisende soll es eine europäische Plattform zum Buchen von Tickets geben, in der auch alle Informationen über Verzögerungen und Stornierungen verfügbar sein sollen. Ein „europäisches Netflix“ soll Zugang zu allen Inhalten geben, die in der EU öffentlich unterstützt wurden, ohne Geoblocking für einzelne Mitgliedstaaten.
Teilzeit- und Gig-Arbeiter:innen will Volt schützen. Dafür sollen die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet werden, sie wie Vollzeit-Arbeitnehmende zu behandeln. Die Partei fordert ein Recht auf Abschalten und ein Recht auf Home Office. Das soll rechtlich und steuerlich in der gesamten EU möglich gemacht werden.
Linke (Linke)
Wenig überraschend sitzen die deutschen Abgeordneten von Die Linke im EU-Parlament bei der Fraktion der Linken. Die Fraktion ist ideologisch ziemlich divers, entsprechend ist das Parteiprogramm zu digitalpolitischen Fragen eher allgemein gehalten.
Die Fraktion unterstützt laut ihrem Programm die Vorstellungen von Gewerkschaften für eine demokratisch gedachte Transformation zu einer digitalen und ökologischen Wirtschaft, die niemanden zurücklässt. Außerdem soll die EU in „kostenlose und erreichbare“ Telekommunikation investieren.
Arbeiter:innen in der digitalen Plattformwirtschaft sollen als Angestellte anerkannt werden. Auch im Home Office sollen Arbeits- und Sozialrechte durchgesetzt werden.
Die öffentliche Verwaltung soll nach Vorstellung der Linken ausreichend Beamte haben, entbürokratisiert und demokratisch verwaltet werden. Alte Menschen oder Menschen mit Behinderungen sollen angemessene Unterstützung für digitale Verwaltungsgänge garantiert bekommen, um Ausgrenzung zu verhindern.
Die Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz sollen „sozial gerecht“ angegangen werden. Dazu gehört für die Linken auch ein Verbot von biometrischer Überwachung und Emotionserkennung. Auch die Nutzung von KI in Waffensystemen soll verboten werden. Die für die EU-Grenzen zuständige Frontex-Agentur will die Linke abschaffen.
Bündnis Sahra Wagenknecht (Linke?)
Das Bündnis Sahra Wagenknecht existiert erst seit Januar 2024. Anders als im Bundestag sind keine der Linken-Abgeordneten im Europaparlament in die neue Partei übergetreten, deshalb ist die Partei momentan nicht im Parlament vertreten. Momentan ist unklar, ob eventuelle BSW-Abgeordnete der Linken-Fraktion beitreten werden – denn damit würden sie in der gleichen Fraktion wie ihre ehemaligen Parteikolleg:innen sitzen. Das dürfte zu einigen unangenehmen Seitenblicken führen.
Größter digitalpolitischer Punkt des BSW-Programms für die Europawahl ist, dass das Gesetz für Digitale Dienste zurückgenommen werden soll. Das Gesetz verpflichtet Onlineplattformen etwa, ihre Moderationsregeln durchzusetzen und offenzulegen, wie viele Moderator:innen sie für einzelne EU-Sprachen beschäftigen. Laut dem BSW-Programm ist das Gesetz ein „Angriff auf die Ausübung grundrechtliche geschützter Freiheiten wie der freien Meinungsäußerung und mit dem europäischen Erbe der Aufklärung nicht vereinbar.“
Die Partei fordert außerdem eine europäische Digitalstrategie, die für mehr Unabhängigkeit von USA und China sorgen soll. Dazu soll auch ein europäisches Zahlungssystem gehören. Die Partei will auch die „Flut an bürokratischen Übergriffen auf Unternehmen und Bürger stoppen“ und Übergriffe in die Belange der EU-Mitgliedstaaten verhindern.
Um gegen Korruption vorzugehen, fordert BSW ein verpflichtendes EU-Transparenzregister für Parlament, Kommission und Rat. Außerdem soll es eine Karenzzeit bei Wechseln zwischen Politik und Wirtschaft geben, um den Drehtüreffekt einzudämmen. Als Kontext: Die EU-Kommission hat bereits ein verpflichtendes Transparenzregister. Für Kommissionsbeamte gilt beim Ruhestand auch bereits eine verpflichtende Karenzzeit, die länger ist als die in Deutschland.
Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Linke?)
Die Partei ist wohl besser bekannt als Tierschutzpartei. Zu Beginn der letzten Legislatur saß ihr Abgeordneter in der Linken-Fraktion. Doch dann stolperte er über seine NPD-Vergangenheit, wurde zum Rücktritt aufgefordert und trat stattdessen aus der Partei aus.
In ihrem „Umsetzungsprogramm“ zur Europawahl ist der Tierschutzpartei das Thema Hinweisgebende und Pressefreiheit wichtig, sie zitieren den Fall von Julian Assange. Die Partei will daher die „Bereitstellung sicherer und vertraulicher Whistleblowerinnen-Meldeplattformen unterstützen“.
Bei Künstlicher Intelligenz schwankt das Programm zwischen „Fortschritt“ und „ernsthaften Risiken“, besonders bei Kriegswaffen. Hier will die Tierschutzpartei Gefahren und Chancen erforschen. Ein weiteres Problem sieht sie beim Datenschutz: „ Die Verarbeitung großer Mengen persönlicher Daten durch KI-Algorithmen birgt die Gefahr von Missbrauch und Verletzungen der Privatsphäre.“ Außerdem sei das Training von KI-Modellen energieintensiv.
Als Folge dessen fordert die Partei einen „bewussten und vorsichtigen“ Ansatz, etwa durch Forschungseinrichtungen oder die Förderung ehtisch-ökolgisch orientierter Startups. Bei Schäden durch KI-Systeme soll es klare Haftungsregeln geben.
Wie viele andere Parteien auch strebt die Tierschutzpartei ein Recht auf Home Office an, Aufklärung über Internetgefahren in der Schue und mehr internationale Zusammenarbeit bei der Ahndung von Gesetzesverstößen im Netz. Unternehmen sollen Hate Speech, Fake News und Deepfakes schneller löschen müssen.
FDP (Renew)
Die Renew-Fraktion im Parlament ist in verschiedene Gruppierungen unterteilt – die Fraktion konnte sich noch nicht einmal auf eine gemeinsame Spitzenkandidatin für den Posten der EU-Kommissionpräsidentin einigen. Die FDP ist Teil der größten, der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE). Die Partei ist liberal, neue Steuern sieht sie etwa gar nicht gern.
Technologie soll durch Regeln „zum Aufbau eines demokratischen, kreativen und humanistischen öffentlichen Raums beitragen“, heißt es im Programm der Partei. Eine einheitliche digitale EU-Aufsichtsbehörde soll ein sicheres Online-Umfeld sicherstellen und Frauen und Mädchen schützen. ALDE lehnt das Vorhaben für eine Chatkontrolle klar ab. Ein europäischer Fonds soll unabhängige Medien vor Einschüchterungsklagen schützen.
Das Potenzial von KI soll ausgeschöpft werden, um die Wirtschaft anzukurbeln und das Leben von Europäer:innen zu verbessern. Regeln zum Schutz der Grundrechte sollen autoritäre Praktiken verhindern.
Die Partei will sich auf die Umsetzung der Digitalgesetze konzentrieren, die in den letzten fünf Jahren beschlossen wurden. Wenn es doch neue Gesetze gibt, sollen die sich auf Anreize, Technologieoffenheit und die Kraft der Innovation konzentrieren. Den Netzausbau will die Partei durch straffere Genehmigungsverfahren vorantreiben, ohne neue Finanzmittel zuzuweisen.
Die Partei will nicht, dass Mitgliedstaaten finanziell „über ihre Verhältnisse“ leben können. Stattdessen soll es für sie Anreize geben, Investitionen auf den digitalen Wandel auszurichten. Unternehmen sollen all ihren Meldepflichten über ein einheitliches europäisches Meldeportal nachkommen können.
ALDE will grundlegende Regeln für den Einsatz digitaler Technologien in der Kriegsführung. Die EU soll besser gemeinsam auf digitale Bedrohungen reagieren können. Kritische Infrastrukturen Europas sollen keine Schwachstellen haben. Frontex soll reformiert werden.
Freie Wähler (Renew)
Die zweitgrößte Gruppierung innerhalb der Renew-Fraktion ist die Europäische Demokratische Partei (EDP). Sie legt ihren Fokus eher darauf, dass Europa autonomer werden muss, ähnlich wie es Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert. Laut ihrem Parteiprogramm ist die Digitalisierung „der Sockel, auf dem Zukunft Europas beruht“. In Deutschland gehören die Freien Wähler zur EDP.
„Wir sehen in Künstlicher Intelligenz eine Chance für die Menschheit und haben Vertrauen in sie“, heißt es im Programm der EDP. KI wird „der Schlüssel für die Zukunft sein“. Die Partei will deshalb „signifikante Mittel“ in Forschung, Entwicklung und Nutzung von KI investieren.
Die Partei fordert, dass europäische Daten in der EU gespeichert und verarbeitet werden sollen. Vereinbarungen mit großen Tech-Unternehmen sollen sicherstellen, dass ihre Angebote auch weniger bekannte Sprachen unterstützen und so die sprachliche Diversität der EU fördern.
In der Wirtschaft soll für kleine Unternehmen und Forscher einfacher sein, an EU-Förderung zu kommen. Digitalriesen und Kryptowährungen sollen besteuert werden. Die EU-Mitgliedstaaten sollen gemeinsam in Digitalprojekte investieren. Der digitale Euro soll die „Avantgarde des 21. Jahrhunderts“ werden und Europas Souveränität gegen andere Großmächte verteidigen.
Verwaltungsmaßnahmen will die EDP vereinfachen. Die Verwaltung soll bei der Beschaffung europäische Software bevorzugt behandeln. Eine neue EU-Stelle soll überwachen, dass digitale Verwaltungsdienste interoperabel werden.
Die EZB soll Transaktionen mehr überwachen, um gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzugehen. Kritische Informationssysteme sollen regelmäßig auf ihre Cybersicherheit geprüft werden.
Die EDP will ein Recht auf Abschalten und ein Recht auf Home Office. Bildung für digitale Kompetenzen hält sie für sehr wichtig. Die Partei will ein „legales digitales Alter“ festlegen und automatische elterliche Kontrollen einführen, um junge Menschen im Internet vor unangemessenen Inhalten zu schützen. Gemeinsame Ticketsysteme soll die Nutzung öffentlicher Verkehrssysteme vereinfachen.
SPD (Sozialdemokraten)
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Europas, die sitzt im EU-Parlament in der Fraktion der Sozialdemokraten. So einfach kann es sein.
Die Partei fordert einen Investitionsplan für die grünen und digitalen Transitionen. Damit soll die europäische Wirtschaft innovativ und wettbewerbsfähig werden. Die digitale Transformation soll dabei die Grundrechte der EU beachten. Wenig konkrete „Regeln“ sollen europäische Demokratien vor Desinformation und Hassrede schützen. Was offline illegal ist, soll auch online illegal sein.
Die Partei will besseren Zugang zu schnellem Internet und umfangreiche Investitionen in die digitale öffentliche Infrastruktur und digitale Bildung. Außerdem will sie Telefon- und Internetbetrug bekämpfen.
Die Sozialdemokraten wollen die Zusammenarbeit von Polizei und Gerichten verbessern und so unter anderem gegen Cyberverbrechen vorgehen. Die Grenzen der EU sollen gestärkt und wirksam kontrolliert werden, gleichzeitig sollen Rechte und Sicherheit von Personen geschützt werden. Die EU soll im Bereich Cybersicherheit und beim Schutz kritischer Infrastruktur enger zusammenarbeiten.
Europa soll die Möglichkeiten von KI ausnutzen, fordern die Sozialdemokraten. Dabei sollen aber Menschen immer die Kontrolle behalten und so Arbeiter:innen und Bürger:innen geschützt werden. Big Tech oder Algorithmen sollen niemals Demokratie oder Arbeiter:innenrechte schwächen.
Die PARTEI (fraktionslos)
Zwei Abgeordnete hatte die Satirepartei Die PARTEI zu Beginn der Legislatur. Nico Semsrott trat aus, Martin Sonneborn blieb übrig, gehört jedoch keiner Fraktion an.
Das spezielle Wahlprogramm zur Europawahl besteht aus einigen knappen Stichpunkten. Netzpolitisch „relevant“ ist die vermeintliche Forderung, dass Lösungen für Abiturprüfungen vorher auf TikTok veröffentlicht werden sollen oder dass Amazon wegen „nachhaltigen Marktmisserfolgs“ geschlossen werden soll.
Die Privatsphäre will Die PARTEI laut dem Programm abschaffen, zumindest für Politiker:innen. Da will die Partei „Patientenakten und Mails“ sowie „Sex-Zeug“.
Zur Quelle wechseln
Zur CC-Lizenz für diesen Artikel
Author: Maximilian Henning