Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.
Mal wieder stellt das Innenministerium geplante Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus vor. Viel gänzlich neues ist nicht dabei, anderes hat Kollateralschaden-Potenzial. Ein Überblick.
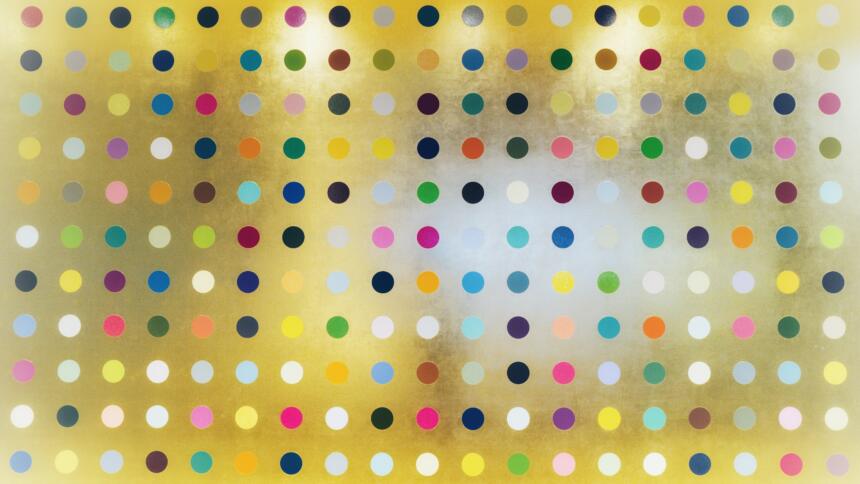
Nach den Morden von Hanau legte die damalige Große Koalition 89 Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Rassismus vor. 2022 rief Innenministerin Nancy Faeser einen Aktionsplan mit 10 Punkten für „Prävention und Härte“ aus. Jetzt, zwei Jahre später, sind es 13 Vorhaben, die das Problem mit Rechtsradikalismus „entschlossen bekämpfen“ sollen. Nicht alle sind neu, nicht alle sind mit tatsächlichen Gesetzesänderungen verbunden – aber manche könnten zu Kollateralschäden führen.
Demokratische Institutionen absichern
Kein neues Problem, aber ein neues Problembewusstsein und eine neue konkrete Planung markiert der gleich der erste Punkt aus Faesers Vorhabenkatalog mit dem Titel „Resilienz der Demokratie stärken“. Was hier gemeint ist, ist nicht „die Demokratie“ als Ganzes, sondern vor allem ihre Institutionen. Schon vor Jahren haben Rechtsexperten darauf hingewiesen, dass beispielsweise das Bundesverfassungsgericht wackeln könnte, wenn eine entsprechend gewillte Regierung an die Macht käme. Mit den anstehenden Landtagswahlen wird dieses Risiko zumindest auf Landesebene immer konkreter und im Bund bewegt sich etwas.
Vor allem da, wo es um Änderungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes geht und nicht mit einer Zweidrittel-Mehrheit das Grundgesetz geändert werden müsste. Ersteres regelt zum Beispiel die Ernennung der Richter:innen – und die könnten mit einer einfachen Gesetzesänderung – so die Befürchtung – nach Gusto einer potenziell rechtsradikalen Regierung ausgetauscht werden, damit sie keinen Ärger machen.
Seit Januar diskutiert die Regierung daher, mehr Regelungen zum Bundesverfassungsgericht ins Grundgesetz zu ziehen, damit sie im Ernstfall nicht ganz so leicht zu ändern sind. Ob das realistisch ist, hängt vor allem von der Mitwirkung der demokratischen Parteien im Bundestag ab. Denn die nötige Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag hätten die Ampel-Parteien nicht allein.
Niedrigere Hürden für den Verfassungsschutz
Im Maßnahmenpaket ist auch eine Befugniserweiterung für den deutschen Inlandsgeheimdienst geplant, die im zweiten Teil der geplanten Reform des Nachrichtendienstrechts kommen soll. Das erklärte Ziel: Finanzströme besser erkennen und die Geldquellen von Rechtsradikalen austrocknen.
Die Formulierung im Papier des Innenministeriums dazu ist aber sehr weit gefasst und bezieht sich keineswegs nur auf Rechte. Dort heißt es konkret:
Die zu hohe Hürde des Verhetzungs- und Gewaltbezugs für Aktivitäten des Verfassungsschutzes in § 8a BVerfSchG soll durch einen auf das Gefährdungspotenzial abstellenden Ansatz ersetzt werden.
Der entsprechende Paragraf regelt, wo und wann der Verfassungsschutz andere nach Auskunft fragen darf. Statt einem konkreten Ansatz für Gewalt und Verhetzung soll künftig bereits ein unbestimmtes Gefährdungspotenzial ausreichen. Das erinnert an den Trend in Polizeigesetzen, Eingriffsbefugnisse schon bei drohender Gefahr anwenden zu können. Diese „drohende Gefahr“ oder hier das „Potenzial der Gefährdung“ ist ein Problem. Denn es lässt sich zum einen schwer objektiv bestimmen und zum anderen schwer im Nachhinein überprüfen.
Die Abstraktion der Gefährdung bezieht sich dabei keineswegs nur auf das derzeit vieldiskutierte Problem mit Rechtsradikalen. Wie im Bundestag bereits zur Sprache gebracht, ließe sich die Ausweitung auch auf andere „Phänomenbereiche“ anwenden, sei es Islamismus oder Linksextremismus.
Neu ist die Idee aber nicht: Schon im letzten Aktionsplan nahm man sich vor, dass der Verfassungsschutz mehr auf die Geldbewegungen von Rechtsradikalen schauen solle. Nun bekommt er dafür nicht nur mehr Mittel, sondern soll auch mehr dürfen.
Mehr tun, was man schon darf
Nicht mehr dürfen, aber mehr tun, ist der Leitsatz einiger anderer Ankündigungen. Hinter dem vagen zweiten Punkt, „ganzheitlich“ gegen Rechtsextremismus vorgehen zu wollen, verbirgt sich vor allem ein guter Vorsatz: die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten auch wirklich nutzen. Vor allem der Bundesverfassungsschutz soll „seine Datenübermittlungsbefugnisse verstärkt nutzen“. Positiv ist zunächst, dass hier nicht der oft bekannte Ruf nach mehr Befugnissen ertönt. Fraglich ist, wie sich am Ende messen lässt, ob man mit dem Vorhaben erfolgreich war.
Auf ähnlicher Ebene bewegt sich das Vorhaben, rechtsextreme Netzwerke zerschlagen zu wollen, mit den bestehenden Möglichkeiten von Vereinsverboten. Solche Maßnahmen betreffen am häufigsten Vereine mit vermutetem islamistischen Hintergrund und aus dem „Phänomenbereich Ausländerextremismus“. Mehr als 100 solcher Vereine wurden bisher verboten. Aus dem rechtsradikalen Bereich waren es bisher 19.
An der direkten Wirksamkeit von Vereinsverboten gibt es Zweifel. Nach dem Verbot des deutschen Ablegers der Neonazi-Organisation „Blood and Honour“ lebten die Strukturen dennoch weiter. Unter anderem bei „Combat 18“, das wiederum 20 Jahre später verboten wurde. Der Politikwissenschaftler Christoph Kopke sagte der Tagesschau, dass Verbote sicherlich Symbolpolitik seien, aber deswegen nicht falsch: „Weil es wichtig ist, dass Politikerinnen und Politiker bestimmte Dinge erklären und ein Staat Zeichen setzt“.
Gegen Nazi-Inhalte im Netz
Auch ohne neue Vorschläge für mehr Befugnisse kommen die Teile des Plans aus, die sich direkt auf das Internet beziehen. Strafbare Inhalte sollen gelöscht und verfolgt werden, die rechtlichen Grundlagen dafür sind durch das Digitale-Dienste-Gesetz der EU gelegt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die BKA-Meldestelle, die personell aufgerüstet werden soll – auch das ist bereits geplant gewesen.
Bei gezielter Desinformation aus dem Ausland soll es indes eine neue „Früherkennungseinheit“ im Innenministerium geben. Wie sich diese zu bereits bestehenden Aufdeckungsbemühungen aus anderes Ressorts verhält, ist nicht näher bestimmt. Zuletzt meldete etwa das Auswärtige Amt, auf dem früheren Twitter eine systematische Kampagne aus Russland entdeckt zu haben. Auch im Innenministerium gibt es bereits eine spezielle „Taskforce“ seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine.
Was fehlt?
Interessant ist auch, was in den Vorschlägen nicht enthalten ist. Der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster weist darauf hin, dass Faeser „die inzwischen unübersehbare Bedrohung von Medien und Journalismus durch die rechtsextremen Verfassungsfeinde mit keiner einzigen Zeile erwähnt“. Unter dem Punkt „Angegriffenen Demokratinnen und Demokraten den Rücken stärken“ werden ausschließlich Kommunalpolitiker:innen explizit aufgeführt.
Eine einfache Maßnahme, die hier schnell Abhilfe schaffen könnte: eine Änderung der Impressumspflicht, sodass freie Medienschaffende, Aktivist:innen und andere nicht mehr ihre Privatadresse veröffentlichen müssen. Von der Linken oftmals gefordert, gab es dazu bisher noch keine Mehrheit. Doch das Bedrohungspotenzial für viele, die ihre Stimme gegen Rechtsradikalismus im Netz erheben, ließe sich dadurch deutlich mindern – ebenso wie die Abschreckung, das zu tun.![]()
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Zur Quelle wechseln
Zur CC-Lizenz für diesen Artikel
Author: Anna Biselli
